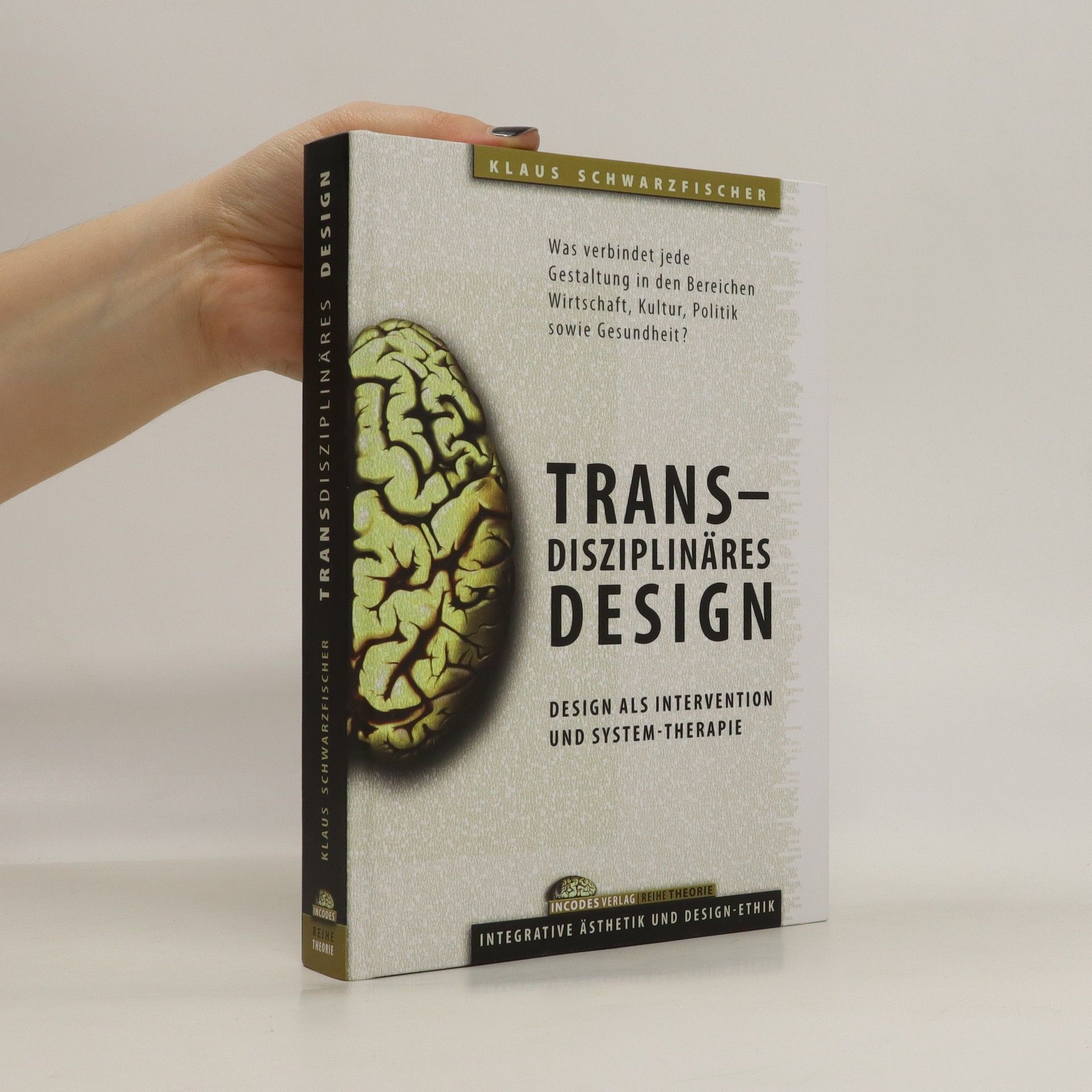Parametre
Viac o knihe
In der Diskussion über Kunst und Design wird häufig ein Selbstverständnis der Designer als Künstler betont, begleitet von der Klage über kommerzielle Einflüsse und Missverständnisse. Diese Argumentation bleibt jedoch oft unreflektiert, da die Begriffe „Kunst“ und „Design“ selten definiert werden. Stattdessen wird eine binäre Unterscheidung zwischen „Kunst“ und „Nicht-Kunst“ aufrechterhalten, die verschiedenen Interessengruppen wie Künstlern, Kunsthistorikern und Händlern Vorteile in Form von Geld, Status und sozialen Kontakten verschafft. Diese Exklusionsrhetorik dient der Schaffung von Eliten und wird nicht hinterfragt, da das Infragestellen der Begriffe als unangemessen gilt. Kunst wird oft als etwas Transzendentales betrachtet, das nicht verbal erklärt werden kann, was an schamanistische Praktiken erinnert. Historisch betrachtet zeigt sich, dass diese exklusive Sichtweise in Zeiten entstand, als die Aufklärung begann, die Religion zu hinterfragen. Der Begriff „Kunst“ hat sich über die Jahrhunderte gewandelt und sollte nicht als unveränderlich angesehen werden. Die Entwicklung von Kunst hin zu einem sozialen System, das Kommunikation thematisiert, führt zu einer neuen Perspektive: Kunst als Prozess der Wahrnehmung, der nicht an spezifische Artefakte gebunden ist. Letztlich ist es notwendig, von binären Unterscheidungen abzukommen und graduelle Unterschiede zu betrachten, um die Komplexität von Kunst und Design zu verstehen
Nákup knihy
Transdisziplinäres Design, Klaus Schwarzfischer
- Jazyk
- Rok vydania
- 2010
Doručenie
Platobné metódy
Nikto zatiaľ neohodnotil.